Unsere Kollegin Stephi Faugel hat zwei Wochen Bildungsurlaub auf einer archäologischen Ausgrabungsstätte in Israel verbracht. Wieso Dreck dabei eine so große Rolle spielt und wie es ihr dabei ergangen ist, berichtet sie heute auf unserem Blog.
Bildungsurlaub. Das klingt nach ausgedehnter Fortbildung, zu erledigenden Uni-Kursen oder romantischer Selbstfindungsreise. Selten werden Dreck, Schweiß und harte körperliche Arbeit damit assoziiert. Ich habe zwei Wochen lang auf Knien im Grund gewühlt, überquellende Erd-Eimer geschleppt, gehackt, gekehrt und dabei unverhältnismäßig viel geschwitzt. Kurzum: Ich durfte zwei Wochen lang Archäologin in Israel sein – oder zumindest so tun, als ob.
Freiheit der Gedanken durch monastische Routine
Um 4:45 Uhr riss der Wecker mich aus den nicht vorhandenen Träumen – zu erschöpft dafür. Nach einer kurzen Busfahrt galt es den Tell (תל, Hebr., Ruinenhügel) Keisan zu erklimmen, bepackt mit Styropor-Wasserkanistern, die für den Tag reichen mussten. Schattensegel wurden gespannt, Kellen bereitgelegt und bei 30 Grad im Schatten um 7 Uhr morgens der erste Liter Wasser inhaliert.

 Zwischen Frühstück und Obst-Pause war ich akribisch damit beschäftigt, die Vergangenheit ans Tageslicht zu holen. Knochen, Olivenkerne, Perlen, Figurinen oder gänzlich erhaltene Gefäße ließen einen staunen, wie lange die Menschheit bereits ihr Unwesen auf der Erde treibt. Freigelegte Oberflächen und Mauerreste lieferten der eigenen, unbedarften Vorstellung architektonisches Anschauungsmaterial.
Zwischen Frühstück und Obst-Pause war ich akribisch damit beschäftigt, die Vergangenheit ans Tageslicht zu holen. Knochen, Olivenkerne, Perlen, Figurinen oder gänzlich erhaltene Gefäße ließen einen staunen, wie lange die Menschheit bereits ihr Unwesen auf der Erde treibt. Freigelegte Oberflächen und Mauerreste lieferten der eigenen, unbedarften Vorstellung architektonisches Anschauungsmaterial.
Zurück im Kibbuz (קִבּוּץ, Hebr., urspr. Gemeinschaftssiedlung mit geteiltem Eigentum und basisdemokratischen Strukturen) wurden Kohlenhydrat-Speicher neu befüllt, Dreck und Schweiß von der Haut geschrubbt und Mittagsruhe gehalten. Nachmittags musste die gefundene Keramik gewaschen und schließlich zu dessen Bestimmung ins „Pottery Lab” gebracht werden. Mal gab es abends Vorträge der verantwortlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen, mal war ich dankbar um ein kühles Bier, mal gab ich mich sofort den nicht vorhandenen Träumen hin. Eigene Entscheidungen traf ich selten. Ich musste nicht. Es wirkte befreiend.
Fischen in fremden Gewässern
Im Februar hörte ich zum ersten Mal von dem Projekt, als ich ein Erasmus-Semester an der Humboldt-Universität zu Berlin absolvierte. So fand ich mich vor meinem Laptop hängend wieder, wie ich eine, für meine Verhältnisse, halb amüsierende, halb ironische Bewerbung für ein Kooperationsprojekt der Humboldt-Universität, University of Chicago und Ben Gurion Universität, Israel, verfasste. Von der positiven Rückmeldung war ich überrascht.

Und nun? Zwei Wochen Urlaub beantragen, um mich körperlich an meine Grenzen zu treiben, in einem mir fast gänzlich unbekannten Land, innerhalb einer mir ebenfalls unbekannten Gruppe? Die fehlende masochistische Ader in mir ließ mich andere Wege suchen. So kam es zu zwei Wochen Bildungsurlaub und dem Deal, das Social Media-Management der Ausgrabung in dieser Zeit zu übernehmen.
Alles ist Content
Genaue Vorgaben gab es keine. Mir bot sich eine schier endlose Spielwiese. Alles war potenzieller Content – jeder Arbeitsschritt, jeder Fund, die Stimmung im Team, die beeindruckende Szenerie, die einen umgab. Schlussendlich pendelte es sich mit durchschnittlich drei Postings pro Tag, mindestens fünf Tage die Woche, bei einem vergleichsweise hohen Pensum ein.
Hier geht es zum Feed.

Den Schwerpunkt habe ich auf Instagram-Reels gelegt, da Bewegtbilder tendenziell mehr Reichweite generieren. Das bedeutet zwar immense Schneidearbeit, aber auch höhere Klickzahlen und Profilaufrufe. Storys und Carousel-Posts sollten den Algorithmus zusätzlich stimulieren. Mittels gezielt gewählter Thumbnails wurde der Feed dem Thema optisch angepasst: Offene, neugierige Gesichter und Erd- und Orangetöne waren das Motiv. Um Inhalt zu generieren, habe ich während der Arbeit im Feld versucht, in Echtzeit zu agieren: Neue Funde sofort abgefilmt, Stimmungsumfragen gemacht, routinierte Abläufe filmisch begleitet. Authentizität war dabei oberstes Gebot. Der Content würde sich nur abheben, wenn er echt ist – dem spannenden Team und der faszinierenden Arbeit vor Ort gerecht wird.
Nach Sichten des Materials und dessen Bearbeitung setzte sich die Arbeit nachmittags vor allem in Expert:innengesprächen fort. Für mich als fachfremde Person waren diese nötig, um auch inhaltlichen Mehrwert in den Bildunterschriften liefern zu können. Eine erfolgreiche Social Media-Strategie beinhaltet nicht allein spannende visuelle Reize. Ohne stichhaltige inhaltliche Anbindung wird jede Darstellung belanglos. Das Projekt ermöglichte mir, meine Video Editor-Fähigkeiten auszubauen, effizienter Content zu produzieren und meinen Blick für Geschichten, die erzählt werden wollen, zu schärfen.
Fazit
Ich bin dankbar in Tonka einen Arbeitgeber gefunden zu haben, der bereit ist, Kreativität, Neugier und Ehrgeiz zu unterstützen. Und Dank gebührt auch dem verantwortlichen Institut „Geschichte Israels in der altorientalischen Welt” der HU, für das in mich gesetzte Vertrauen. Mit zwei viral gegangenen Reels (hier und hier) und über 120 organisch neugewonnen Followern, gänzlich ohne Bewerbung oder Sponsoring, sollte dieses zumindest entlohnt sein.
Bildungsurlaub. Das war Fortbildung, Uni-Kurs und Selbstfindungsreise. Ich bin mir, meinen Fähigkeiten, meinem Selbstvertrauen, meinen Gefühlen und meinem Mindset gänzlich neu begegnet. Kurzum: Eat, Pray, Love im Heiligen Land.


 PR
PR Content Marketing
Content Marketing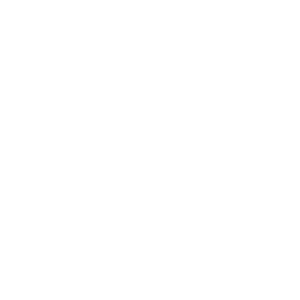 SEO
SEO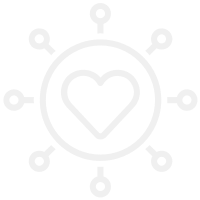 Social Media
Social Media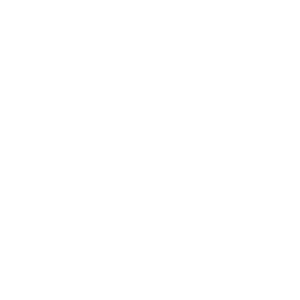 Influencer Marketing
Influencer Marketing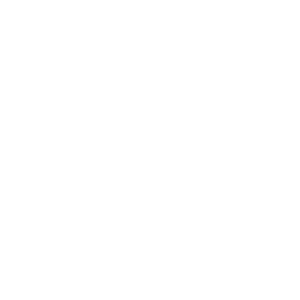 Grafikdesign
Grafikdesign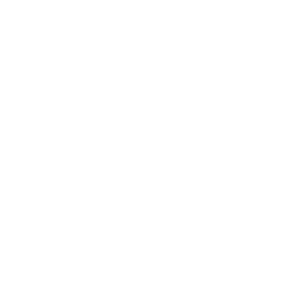 Copywriting
Copywriting